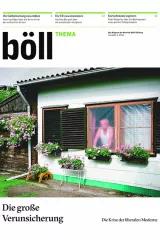Wenn vom Regierungsmodell der westlichen Demokratie gesprochen wird, ist stets die verfassungsstaatliche oder liberale Demokratie gemeint. Die Demokratie gründet mithin auf zwei Legitimationsprinzipien, die nicht identisch sind. Das eine Prinzip, das man als Demokratie im engeren oder ursprünglichen Sinne bezeichnen könnte, ist die Volkssouveränität. Sie postuliert, dass Herrschaft stets unter Berufung auf den Willen des Volkes beziehungsweise der Mehrheit des Volkes ausgeübt wird. Der Konstitutionalismus ist demgegenüber ein Prinzip der Herrschaftsbegrenzung, das dafür sorgt, dass die vom Volk beauftragten Herrschenden in ihrer Machtausübung kontrolliert werden. Um die Freiheit des Individuums vor staatlichen Übergriffen zu schützen, definiert der Verfassungsstaat einen Bereich garantierter Rechte, über die keine demokratische Mehrheit – sei sie auch noch so groß – verfügen kann.
Historisch betrachtet geht der Verfassungsstaat der neuzeitlichen Demokratie voraus. Letztere setzte sich erst mit der Einführung des Frauenwahlrechts vollständig durch. Wenn Verfassungsstaaten ohne Demokratie heute nicht mehr vorstellbar sind, so kann es auf der anderen Seite durchaus demokratische Systeme geben, denen es an einem stabilen verfassungsstaatlichen Fundament mangelt. Diese Systeme zeichnen sich durch das Vorhandensein freier, gleicher und allgemeiner Wahlen aus, verstoßen aber zugleich gegen elementare Prinzipien des Verfassungs- und Rechtsstaates, indem sie die Menschen- und Bürgerrechte missachten oder die Gewaltenteilung umgehen.
Letzteres schlägt sich unter anderem in einem Machtübergewicht der Exekutive zulasten des Parlaments und der Justiz sowie in einer generellen Missachtung des Rechts nieder, die oftmals unter expliziter Bezugnahme auf die direkte demokratische Legitimation der Regierenden erfolgt.
Das Vorbild Putin
Als die nach dem von unten herbeigezwungenen Systemwechsel neu- oder wiedererstandenen demokratischen Verfassungsstaaten in Mittelosteuropa ihren politischen Transformationsprozess mit dem Beitritt zur Europäischen Union in den 2000er Jahren förmlich «krönten», hätte man nicht vermutet, dass ein Teil von ihnen bald zu Trendsettern einer gegenläufigen Entwicklung werden würde. Was in Ungarn unter der Fidesz-Regierung schon länger im Gange ist – der Umbau des Staates zu einem quasi-demokratischen autoritären System –, kündigt sich nach der Machtübernahme der rechtsnationalen Partei «Recht und Gerechtigkeit» jetzt auch in Polen an. Damit eifern ausgerechnet jene beiden Länder, die den eigenen Freiheitswillen in der kommunistischen Zeit gegen die Sowjetunion am konsequentesten unter Beweis gestellt hatten, dem – von seinem Urheber Wladimir Putin zynisch als «gelenkte» Demokratie titulierten – Herrschaftsmodell des verhassten russischen Nachbarn nach.
Der Nimbus des starken Führers, der Putin trotz oder gerade wegen der ökonomischen Schwäche seines Riesenreiches umgibt, strahlt inzwischen auch auf die «alten» westlichen Demokratien aus. Marine Le Pen und Alexander Gauland fühlen sich ebenso zum demokratischen Autoritarismus hingezogen wie der US-amerikanische Präsidentschaftsanwärter
Donald Trump. So groß die Unterschiede innerhalb der rechtspopulistischen Familie in ideologisch-programmatischer und organisatorischer Hinsicht sein mögen, eint sie der «identitäre» Gegenentwurf zu einem liberalen, universalistischen Politikverständnis, dessen Wohlstands- und Teilhabeversprechen wachsende Teile der heutigen Gesellschaft nicht mehr erreicht.
Verlustängste und soziokulturelle Entwurzelung
in Blick auf die Wählerstruktur der neuen populistischen Parteien legt dabei zwei Differenzierungen nahe: Erstens handelt es sich um «Verlierer» allenfalls in einem relativen Sinne, das heißt: Die Misere dieser Personen ist nicht an ihre tatsächliche soziale Lage gebunden, sondern an empfundene Verlustängste, an das Gefühl, zum benachteiligten und abstiegsbedrohten Teil der Gesellschaft zu gehören. Zweitens sind die Verlustängste nicht in erster Linie durch materielle Erwartungen bestimmt. Stattdessen verweisen sie auf ein tiefer liegendes Problem, das man als sozialkulturelle Entwurzelung bezeichnen könnte und das eine Folge gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse ist. Weil sie die Möglichkeiten einer autonomen Lebensführung, die die globalisierte und digitalisierte Welt eröffnet, nicht nutzen können oder wollen, flüchten sich diese Personen in antiliberale Ressentiments. Zum Hauptkristallisationspunkt ihrer Angst werden dabei die Fremden.
Gegen diese Tendenzen setzen die Rechtspopulisten die Rückbesinnung auf das «Wir-Gefühl» der Nation, die aber nicht mehr nur (oder primär) in einem partikularen Sinne aufgefasst wird, sondern eingebettet ist in ein nationenübergreifend-gemeinsames, (west-)europäisches Verständnis von kultureller Zugehörigkeit, dessen Gegenbild die überwiegend nicht-westliche Zuwandererbevölkerung verkörpert. Dies findet auch in organisatorischer Hinsicht Niederschlag. Nachdem ihre nationale Ausrichtung und die Stigmatisierung als rechtsextrem in der Vergangenheit wechselseitige Berührungsängste ausgelöst hatten, ist die europaweite Zusammenarbeit der neuen Rechtsparteien inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Innerhalb des gemeinsamen ideologischen Kerns weist der Rechtspopulismus eine große inhaltliche Bandbreite auf. Einerseits ergeben sich bei Parteien wie dem Front National
oder den Schwedendemokraten Schnittmengen mit rassistischen und extremistischen Positionen. Andererseits ist der Rechtspopulismus auch an nicht-nativistische Begründungen der kulturellen Identität und gesellschaftspolitisch liberalere Positionen anschlussfähig, wie etwa bei Pim Fortuyn, der sich in seiner Islamkritik ausschließlich auf die liberalen und demokratischen Werte des Westens berief – Trennung von Kirche und Staat, Gleichberechtigung von Mann und Frau und Freiheit der sexuellen Orientierung. In dieser Tradition steht auch die heutige niederländische Freiheitspartei unter Geert Wilders.
Ähnlich facettenreich wie seine «Identitätspolitik» gestaltet sich die wirtschaftspolitische Programmatik. In der Entstehungsphase verfolgten dessen Vertreter noch fast allesamt einen «neoliberalen» Kurs, bevor in den 1990er Jahren in den meisten Parteien protektionistische Positionen die Oberhand gewannen. Statt den Wohlfahrtsstaat zu verschlanken, sollte dieser nun verteidigt und sogar weiter ausgebaut werden. Dazu galt es auch der europäischen Politik in den Arm zu fallen, die sich einseitig auf die Beseitigung der Marktschranken konzentrierte.
Schutz des Wohlstandes
Mit diesem Wechsel nach links entsprachen die neuen Rechtsparteien nicht nur ihrer veränderten Wählerbasis, die sozial-populistischen Forderungen knüpften auch an die identitätspolitischen Kernthemen der Zuwanderungsbegrenzung und Multikulturalismuskritik an. Die Rechtspopulisten konnten damit den linken Parteien zum Teil das Wasser abgraben bzw. das Aufkommen neuer linkspopulistischer Konkurrenten verhindern. Die in der Literatur als «Wohlfahrtschauvinismus» bezeichnete Haltung, wonach der eigene Wohlstand vor der ungerechtfertigten Inanspruchnahme durch «Dritte» (seien es Zuwanderer oder seien es Angehörige anderer Nationen) zu schützen sei, traf und trifft vor allem in den wirtschaftsstarken Ländern auf fruchtbaren Boden, die ein vergleichsweise hohes sozialstaatliches Leistungsniveau aufweisen.
Hatte es zu Beginn der 2000er Jahre noch Anzeichen für eine allmähliche Erschöpfung der populistischen Mobilisierungsfähigkeit gegeben, so verstärkten die am 11. September 2001 in den USA beginnende Serie islamistischer Terroranschläge, die durch die Bürgerkriege im Nahen Osten seit 2013 stark ansteigenden Flüchtlingszahlen sowie die 2007 ausgebrochene Finanz- und Eurokrise die bereits vorhandene Unsicherheit. Während die Angst vor dem Islam Wasser auf die Mühlen der rechten Einwanderungskritiker lenkte, verschaffte die Finanz- und Eurokrise den linkspopulistischen Kritikern des «neoliberalen» Modernisierungsprojekts neuen Zulauf. Dessen Schattenseiten hatten sich in Europa schon in den 1990er Jahre zunehmend bemerkbar gemacht und dafür gesorgt, dass auch jene Rechtspopulisten, die wie etwa die Lega Nord vorher zum Teil noch pro-europäisch aufgestellt waren, nun zu rigorosen EU-Gegnern mutierten. Folgt man deren Argumentation, steht die Europäische Union stellvertretend für sämtliche Kehrseiten der Modernisierung: materielle Wohlstandsverluste, multikulturelle «Überfremdung» und Krise der politischen Repräsentation. Die sonst so abstrakte Globalisierung findet mit ihr einen konkreten Schuldigen.
Die Ambivalenz des Rechtspopulismus
So wenig der Rückzug auf den Nationalstaat und das von den Rechtspopulisten propagierte autoritäre Demokratiemodell geeignet sind, den Problemen des Regierens in der globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft zu begegnen, so falsch wäre es, darin nur Rückwärtsgewandtheit zu erkennen. Das Aufeinanderfolgen von Öffnungs- und Schließungseffekten ist ein Kennzeichnen jeglicher Modernisierungsprozesse. Indem die populistischen Herausforderer das Augenmerk auf dessen negative Begleiterscheinungen legen, könnten sie also einen Beitrag leisten, dass die Protestgründe aufgenommen werden und auf diese Weise eine neue politische Balance entsteht. Solange die Rechtspopulisten diese Protestfunktion aus der Opposition heraus wahrnehmen, dürfte von ihnen für die verfassungsmäßige Ordnung keine Gefahr ausgehen. Bedenklich wird es erst, wenn sie selbst über (ungeteilte) Regierungsmacht verfügen und ihre autoritären Demokratievorstellungen – wie in Ungarn und Polen – aktiv betreiben können.
Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus dem Scheitern der bisherigen Bekämpfungsstrategien des Rechtspopulismus ableiten? Neben der unmittelbaren politischen Auseinandersetzung, die sich als Empfehlung von selbst versteht, erscheinen die folgenden drei Aufgaben wesentlich. Erstens muss man versuchen, der Konkurrenz auf deren eigenem Feld zu begegnen – der Wertepolitik. Dies stellt vor allem für die in ihrem Werteverständnis eher materialistisch geprägten Sozialdemokraten ein schwieriges Problem dar, die verloren gegangenen Kredit aber nur zurückgewinnen können, wenn sie der rechten «Gegenmodernisierung» ein eigenes, nicht-regressives Modell einer guten Gesellschaft entgegenstellen, das die Bedürfnisse der Menschen nach Zugehörigkeit aufnimmt. Dies gilt vor allem für die Zuwanderungspolitik.
Zweitens muss man deutlich machen, warum eine Politik, die die Märkte auf der europäischen und transnationalen Ebene reguliert und dazu nationale Zuständigkeiten abgibt (bzw. abzugeben bereit wäre), dennoch im nationalen Interesse ist. Diese Herausforderung stellt sich in der Auseinandersetzung mit dem rechten und linken Populismus gleichermaßen. Die zunehmend europamüden Bürger lassen sich für das Integrationsprojekt nur zurückgewinnen, wenn die sozialen und kulturellen Nebenfolgen, die sich aus dem Marktgeschehen ergeben, nicht mehr ausschließlich der nationalstaatlichen Politik aufgebürdet werden. In anderen Bereichen– etwa der Außen- und Verteidigungspolitik– wäre es geboten, dass die politischen Eliten selbst über ihren Schatten springen; hier scheitert die Überwindung des nationalen Denkens nicht an den Widerständen der Bevölkerung.
Und drittens müssen die Parteien sich nach außen hin gegenüber den Bürgern öffnen. In einer Gesellschaft, die über das Internet immer stärker vernetzt wird, ist das heutige Modell der von oben gesteuerten Mitglieder- und Funktionärsparteien nicht mehr adäquat. Überlegt werden sollte auch, wieweit die (auf der Bundesebene) bisher ausschließlich repräsentativen Entscheidungsprozesse durch direktdemokratische Verfahren verbessert werden könnten. Vor allem braucht es eine neue Kultur des Zuhörens und aufeinander Zugehens. Die in einer Demokratie unverzichtbare Volksnähe des Politikers gebietet nicht, dem Volkswillen hinterherzulaufen, sondern den Bürgern Gehör zu schenken. Dies setzt voraus, dass man die Lebenswirklichkeiten seiner Wähler kennt, ihnen zumindest nicht ausweicht.
Frank Decker ist Professor für Politikwissenschaft an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.